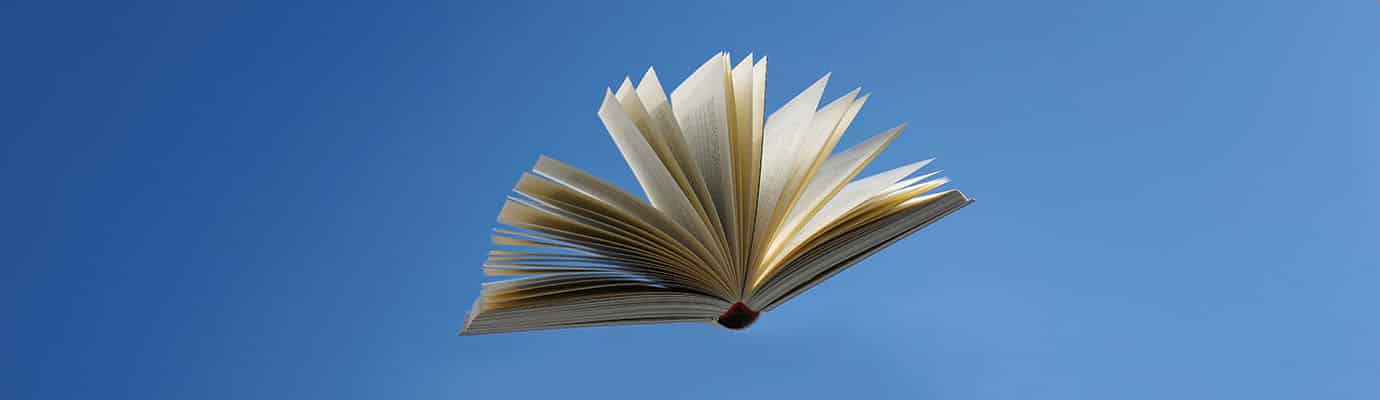Der Bericht der „Worlds of Journalism Study” (WJS3) mit dem Titel „Journalism Under Duress” ist jetzt open access verfügbar. Auf der Grundlage von Antworten von über 32.000 Journalist*innen in 75 Ländern untersucht der Bericht, wie Journalist*innen weltweit mit Risiken, Unsicherheiten und Veränderungen in der sich rasch wandelnden Medienlandschaft von heute umgehen.
 Forschungsteams führten auf Grundlage eines gemeinsam entwickelten Fragebogens repräsentative Befragungen von Journalist*innen in ihren Ländern durch. Dabei befassten sie sich mit der Sicherheit von Journalist*innen, redaktioneller Freiheit, beruflichen Rollen, Einflüssen auf Nachrichten und Arbeitsbedingungen.
Forschungsteams führten auf Grundlage eines gemeinsam entwickelten Fragebogens repräsentative Befragungen von Journalist*innen in ihren Ländern durch. Dabei befassten sie sich mit der Sicherheit von Journalist*innen, redaktioneller Freiheit, beruflichen Rollen, Einflüssen auf Nachrichten und Arbeitsbedingungen.
Unter der Leitung von Prof. Dr. Wiebke Loosen war das HBI für die deutsche Teilstudie „Journalismus unter Druck” zuständig.
Ergebnisse
- Knapp die Hälfte der befragten Journalist*innen identifizierte sich als weiblich, wobei Frauen in 30 Ländern die zahlenmäßige Mehrheit bildeten.
- Journalist*innen im Globalen Norden sind in der Regel älter und verfügen über mehr Berufserfahrung als ihre Kolleg*innen im Globalen Süden.
- Die meisten Journalist*innen haben Vollzeitverträge, allerdings arbeitet mehr als ein Viertel als Freiberufler*innen oder Teilzeitbeschäftigte.
- Weltweit sind Journalist*innen relativ unterbezahlt. Die Gehälter liegen oft um den nationalen Durchschnitt herum, was fast ein Drittel der Journalist*innen dazu veranlasst, sich eine zweite Einkommensquelle zu suchen.
- Weltweit sind die häufigsten Bedrohungen für Journalist*innen psychologischer und digitaler Natur, wobei diese Bedrohungen im globalen Süden häufiger auftreten als im globalen Norden.
- Die europäischen Länder rangieren bei der wahrgenommenen redaktionellen Unabhängigkeit und Medienfreiheit an oberster Stelle, während die Länder in Asien, Afrika und dem Nahen Osten größere Schwankungen aufweisen.
- Die Ergebnisse zeigen, dass regionale Unterschiede in der wahrgenommenen Einflussnahme auf die Nachrichtenproduktion offensichtlich sind. Ethik wird in Nordmazedonien, Chile und auf den Philippinen als einflussreichste Kraft angesehen. Die Medienregulierung ist in Sambia, Nordmazedonien, Sierra Leone und Südafrika am stärksten, während Eigentumsverhältnisse und Gewinnerwartungen in Kanada, Neuseeland, Australien und Teilen Europas als am wenigsten einflussreich angesehen werden.
- Muster auf Länderebene spiegeln den Einfluss politischer und medialer Systeme auf journalistische Rollen wider. Journalist*innen in autoritären Regimes neigen dazu, kollaborative Rollen mehr zu schätzen, während diejenigen in Übergangsdemokratien interventionistische Funktionen betonen.
- Es zeigte sich eine deutliche Kluft hinsichtlich des als Nachrichten getarnten Werbejournalismus: Die meisten Journalist*innen in Europa und Nordamerika lehnten ihn rundweg ab, während in Subsahara-Afrika und Asien eine größere Toleranz zu beobachten war, was unterschiedliche wirtschaftliche Zwänge der Medien widerspiegelte.
- Der rasante digitale Wandel im Journalismus hat die Arbeitsabläufe in den Redaktionen verändert und neue Anforderungen an die Journalist*innen gestellt, von denen zunehmend erwartet wird, dass sie Multimedia-Kenntnisse beherrschen und unter beschleunigten Produktionsfristen arbeiten.
- Die meisten Journalist*innen wussten, auf welchen Plattformen ihre Arbeit erscheinen würde. Websites waren der häufigste Verbreitungskanal, gefolgt von sozialen Medien und Printmedien. Dies unterstreicht sowohl die zentrale Bedeutung digitaler Plattformen als auch die anhaltende Relevanz traditioneller Plattformen.
Unterstützt wurde die globale Kooperation der Journalismusforschung unter anderem von der UNESCO, Reporter ohne Grenzen und der International Federation of Journalists. Die Studienreihe dient Akteuren in Medien, Forschung und Politik als wichtige Informationsquelle (siehe auch www.worldsofjournalism.org).
Downloads
Hier geht es zum englischsprachigen Gesamtreport. Die Ergebnisse für Deutschland finden sich in dem Report auf S. 157-160. Zudem wurden die Ergebnisse der deutschen Teilstudie auch als Video zusammengefasst sowie als Arbeitspapier publiziert.